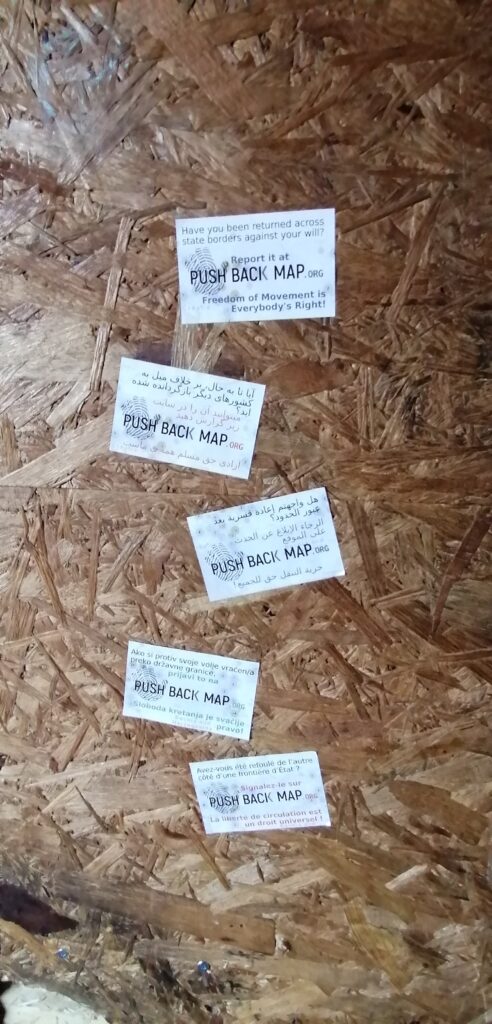Julia, 18.3.:
Heute ist unser letzter Reisetag! Früh fuhren wir vom Nachtquartier in Debrecen aus an die ukrainische Grenze. Eigentlich hatten wir gehofft, dass wir uns schon vorab mit Personen mit Marginalisierungserfahrung zum Abholen verabreden könnten. Über verschiedene Netzwerke hatten wir eine Mitfahrgelegenheit von einer der ungarischen oder auch der slowakischen Grenze zur Ukraine nach Deutschland angeboten. Uns war bekannt, dass die ukrainisch-polnische Grenze schon gut versorgt und organisiert war. Ich war begeistert von den verschiedenen Netzwerken, die sich gebildet hatten, um insbesondere Personen mit Marginalisierungserfahrung zu unterstützen, z.B. mit Behinderungen, BIPoC und LGBTIQ+. Nicht ohne Grund, angesichts u.a. der Rassimus- und Transphobieerfahrungen auf der Flucht, die inzwischen zum Glück weitreichender bekannt sind. Und auch angesichts der Nachrichten aus Russland, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche die westlichen Werte als zentralen Kriegsgrund angibt – so insbesodnere die Pride-Paraden, die angeblich den Zweck hätten zu propagieren, dass „Sünde eine Variante menschlichen Verhaltens“ sei. Kontakt zu Desertierenden herzustellen, stellte sich – nicht überraschend – als weitaus schwieriger dar, und hätte mehr Vorlaufzeit gebraucht. Wir fanden heraus, dass wir wohl zwischen zwei größeren Fluchtbewegungen vor Ort waren: In den ersten Tagen und Wochen des Krieges verließen wohl die meisten BIPoC-Studierenden, sowie Städterinnen mit ihren Kindern die Ukraine. Jetzt wurde an den Grenzübergängen auf die Evakuierten aus Mariupol gewartet, die noch nicht eingetroffen waren. Ansonsten waren zur Zeit wohl eher weniger Privilegierte und Sinti*zze und Rom*nja noch dabei auszureisen. Die Koordinationsstelle der Sinti und Roma Deutschland leitete unser Mitfahrangebot in ihrem Netzwerk weiter, aber der Koordinator vermutete schon im Vorfeld, dass die oft größeren Familien vielleicht lieber zusammen blieben als drei Personen in unserem Auto weiterzuschicken. Und tatsächlich meldete sich auch hier niemand zurück. Da wir über die Situation an den ungarischen Grenzübergängen nicht viel online herausfinden konnten, entschlossen wir uns, direkt an die Grenze bei Berehowe zu fahren. Vorher gaben wir noch die restliche Kinder- und Babykleidung, die wir noch im Auto hatten, für die Flüchtenden beim Roten Kreuz in Debrezen ab – das Lager dort war weder groß noch gut bestückt, und die dortigen Mitarbeiterinnen freuten sich.
Einige Meter vor der ukrainischen Grenze wurden wir von der Polizei direkt in Richtung des „Unterstützungspunktes“ gelotst. Dieser war beeindruckend organisiert – so würde man sich das für alle aus Not und Gefahr flüchtenden Menschen weltweit wünschen! Es gab einen Raum mit Schlafplätzen, eine Spielzeugecke für Kinder, ein (auch für die Helfer*innen kostenloses) Buffet von den Maltesern (inkl. Reismilch für den Kaffee :-))), Ersthelfer*innen, Übersetzer*innen, und natürlich eine Koordinationsstelle. Dort erklärte uns ein zugewandter Mitarbeiter von den Maltesern, dass wir einen Zettel ausfüllen müßten, und sie dann schauen würden, für wen denn unser Fahrtangebot gut passen würde. Nur kostenlose Angebote würden vermittelt. Zunächst war eine Familie mit Hund im Spiel, aber er wollte sich nochmal bei uns melden. So warteten wir auf dem kleinen Hof, und kamen mit einem Inder ins Gespräch, der bereits eine Mitfahrgelegenheit mit einem deutsch sprechenden Ukrainer nach Deutschland hatte. Er erzählte, er arbeitete in Tchernihiv, und sei mehrere Tage unter Beschuß allein einem Hotel gewesen. Dort habe er sich mangels Bunker vor den Raketen unter der Treppe versteckt. Seine Familie in Indien habe er nicht beunruhigen wollen, also habe er nur seiner Schwester gesagt was los war. Schließlich haben ihn Nonnen aus der Stadt gerettet, und auch nach seiner Flucht habe er an der ungarischen Grenze zunächst eine Woche in einem Kloster sich von den traumatischen Erfahrungen etwas erholen können. Nun wolle er zu einem Bekannten nach Essen. Wir tauschen Kontaktdaten aus.
Schließlich kam der freundliche Malteser wieder auf uns zu, und erklärte dass wir eine ukrainische Frau und ihr Kind zum Flughafen nach Budapest mitnehmen könnten. Sie wollten von dort weiter zu Bekannten fliegen. Mit den anderen Verkehrsmitteln vor Ort kämen sie nicht rechtzeitig am Flughafen an. Wir erklärten uns bereit, und wenig später stand die Ukrainerin, mit ihrem Söhnchen von etwa 5 Jahren vor mir. Wir stellten uns kurz vor – sie hieß auch Julia, und sie kämen aus Odessa. Sie sagte sie würden noch kurz ihr Gepäck holen, dann könne es losgehen. Derweil organisierten Uschi und ich einen Kindersitz für den kleinen Jungen, von einem bereitliegenden Kindersitz-Stapel – an alles war gedacht. Mit erschütternd wenig Gepäck kamen Julia und ihr Sohn zurück – in einem kleinen Rucksack und einem noch kleineren Kinderrucksack war ihr ganzes Hab und Gut. Der Junge durfte sich noch etwas von dem Spielzeug an der Station mitnehmen – er wählte eine Art „Kuschel-Monster“ und einen Fisch aus Stoff, den er sich immer wieder ans Gesicht hielt. Ich mußte an den Sohn einer ehemaligen ukrainischen Kollegin denken, der laut ihrem Facebook-Profil sie neulich fragte: „Können wir jetzt nach Hause? Gibt es dort keine Bomben mehr?“.
Aber es gibt sie noch, die Bomben, und so fuhren wir los Richtung Westen mit Julia und ihrem Sohn auf dem Rücksitz. Der Sohn schlief fast die ganze Fahrt über, und Julia schaute still aus dem Fenster – ob sie sich den Frieden anschaute, oder mit dem Krieg in ihrem Kopf beschäftigt war, ich weiß es nicht. Am Flughafen in Budapest begleitete ich sie zu einem weiteren Infopunkt für Ukraine-Flüchtende, wo ihr beim Ticket-Kauf etc weitergeholfen wurde. Wir umarmten uns beide bewegt zum Abschied. Kontaktadressen haben wir nicht voneinander. Ich wünsche ihr und ihrem Söhnchen , dass sie Frieden finden und dass der kleine Junge ein friedliches Herz haben wird und nie wird kämpfen müssen.
In Budapest, so hatte uns der freundliche Koordinator an der Grenze gesagt, gibt es am Keleti-Bahnhof ebenfalls einen Unterstützungspunkt, an dem wir vielleicht Mitfahrende nach Deutschland finden würden. Es dauerte eine Weile, bis wir uns dort im Gewusel der verschiedenen Angebote, Reisenden und Freiwilligen zurechtfanden. Ein älterer Mann fragte ob er helfen könne, und erklärte uns daraufhin ausführlich, dass es hier keinerlei System gäbe und alles ganz chaotisch sei. Schließlich bekamen wir von einer Unterstützererin den Tipp, direkt in der Schlange zum Schalter für die internationalen Tickets zu fragen, ob jemand mitfahren wollte. Meist gäbe es die Tickets nunmehr für die Folgetage, und dann müßten Leute noch Übernachtungsmöglichkeiten finden etc bis sie an ihren Zielort kämen. Wir gingen also an die Schlange, und Uschi sprach direkt zwei junge Afrikaner an, die tatsächlich als Studierende aus der Ukraine kamen und nun nach Deutschland wollten. Wir verabredeten uns für die Fahrt später am Abend. Noch etwas fremd traten wir die nächtliche Reise an. Die beiden sprachen erstmal nicht viel, nur als ich ihnen vorhin erklärte, warum wir ausgerechnet sie angesprochen haben, sagten sie dass sie zwar selbst auf der Flucht ok behandelt worden seien, aber unter ihren nicht-ukrainischen Bekannten es in etwa 50:50 ist, ob man bei der Flucht Rassismus erlebt hat oder nicht.
Als wir in der Abenddämmerung über die Brücke fahren, die die Stadtteile Buda und Pest verbindet, steigt am Horizont ein großer Blut-Vollmond auf. Der Sahara-Staub, der den Mond rot färbt, weht weiter über alle Landesgrenzen hinweg. Wir fahren nach Hause.



[Der Titel dieses Beitrags ist ein Zitat aus dem Lied „Tomorrow Came“ von New Model Army, ebenso stammt der Titel „You weren’t there“ eines vorigen Beitrags von New Model Army. Zahlreiche andere Blog-Titel sind Zitate von Berthold Brecht.]